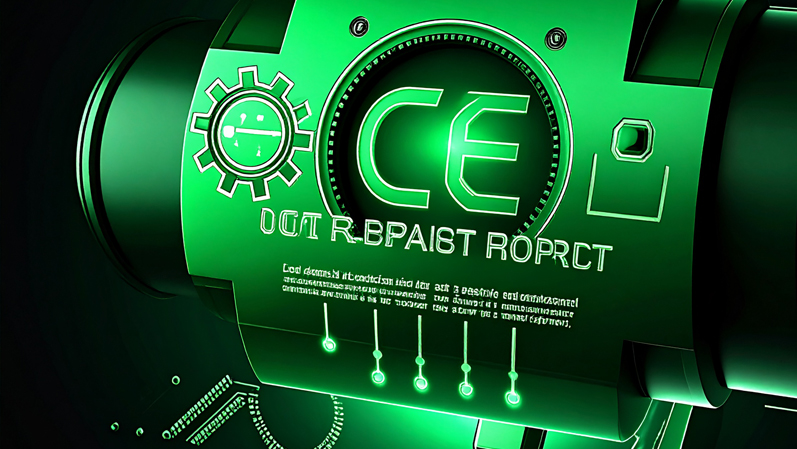Änderungen CE-Kennzeichnung von Maschinen und Produkten ab 2027
Dr. Jan Seyfarth
30.07.2025
Funktionale Sicherheit und Cybersecurity im Produktlebenszyklus gewährleisten
Mit der CE-Kennzeichnung bestätigen Hersteller, dass ihre Produkte alle geltenden EU-Richtlinien und -Verordnungen erfüllen. Ab 2027 gewinnt dieses Zeichen eine neue Dimension: Es wird zum Nachweis für Cybersecurity-Kompetenz. Die neue Maschinenverordnung (MVO) und der Cyber Resilience Act (CRA) fordern Unternehmen heraus, funktionale Sicherheit und digitale Resilienz ganzheitlich zu denken und umzusetzen. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Änderungen auf Sie zukommen – und wie Sie sich strategisch darauf vorbereiten können.
Was bedeutet die neue CE-Kennzeichnung für Maschinen?
Stellen Sie sich vor: Sie bringen im Januar 2027 Ihr neues Produkt, Ihre neue Maschine auf den Markt. Das CE-Kennzeichen ist selbstverständlich dran – wie immer. Doch diesmal kommt der Prüfer nicht nur mit der gewohnten Checkliste und fragt nur nach mechanischer Sicherheit. Er fragt auch nach Ihrem Cybersecurity-Konzept über den gesamten Produktlebenszyklus, nach Ihrer Software-Dokumentation und nach Ihrem Incident-Response-Plan für die nächsten fünf Jahre.
Willkommen in der neuen Realität: Das CE-Kennzeichen wird digital. Für viele werden die neuen Spielregeln ab 2027 eine ungemütliche Wahrheit sein. Denn ab dem 20. Januar 2027 gelten die neue Maschinenverordnung (MVO) und der Cyber Resilience Act (CRA) – und damit ändert sich alles.
Warum Funktionale Sicherheit und Cybersecurity Teil der CE-Kennzeichnung werden
Moderne Maschinen und Produkte sind vernetzt, sammeln Daten, kommunizieren mit anderen Systemen und werden durch Software gesteuert. Diese Digitalisierung bringt zwei kritische Aspekte mit sich:
Funktionale Sicherheit (FuSa) sorgt dafür, dass Ihre Maschine auch bei Fehlern sicher funktioniert. Beispiel: Wenn ein Sensor in einer Produktionsanlage ausfällt, muss die Maschine trotzdem sicher anhalten können.
Cybersecurity schützt vor digitalen Angriffen. Beispiel: Wenn jemand versucht, sich über das WLAN in Ihre Maschine zu hacken, darf das nicht gelingen.
In der digitalen Welt sind beide Aspekte untrennbar miteinander verbunden. Ein Cyberangriff kann die funktionale Sicherheit kompromittieren, und Sicherheitslücken können zu Cyber-Risiken werden.
Praxisbeispiel: Sicherheitsrisiken durch fehlende Integration
Früher wurden Funktionale Sicherheit und Cybersecurity getrennt betrachtet. Das funktioniert heute nicht mehr. Ein Beispiel aus der Praxis:
Montag, 08:00 Uhr: Eine CNC-Maschine in der Produktion läuft normal. Sie hat einen Notausschalter für die Sicherheit und eine WLAN-Verbindung für die Fernwartung.
Dienstag, 14:30 Uhr: Der Notausschalter klemmt nach einem Defekt. Die Maschine kann nicht mehr ordnungsgemäß gestoppt werden. Der Techniker aktiviert den Fernzugriff über WLAN, um die Maschine trotzdem sicher zu steuern.
Mittwoch, 11:15 Uhr: Ein Cyberkrimineller entdeckt die verstärkte WLAN-Nutzung und hackt sich in das System ein. Er kann jetzt sowohl die Maschinensteuerung als auch den "Ersatz-Notausschalter" über das Netzwerk manipulieren.
Donnerstag, 09:45 Uhr: Was als einfacher mechanischer Defekt begann, ist jetzt ein doppeltes Sicherheitsrisiko: Die Maschine kann weder mechanisch noch digital sicher gestoppt werden.
Diese Kettenreaktion zeigt: Ein Safety-Problem wird zum Security-Risiko und umgekehrt. Beide Aspekte sind heute untrennbar miteinander verbunden und erfordern einen integrierten Ansatz. Moderne Digital Engineering-Tools ermöglichen es, solche Wechselwirkungen von Anfang an mitzudenken und beide Aspekte gemeinsam zu entwickeln und zu dokumentieren.

Webinar „Schritt für Schritt durch den Cybersecurity Lifecycle“
Mit dem Wissen aus diesem Webinar können Sie die Cybersecurity Ihrer Produkte nachhaltig und effizient gestalten: Sie erhalten wertvolle Tipps, worauf es in der Konzeptphase, bei Verifikations- und Validierungsmaßnahmen sowie beim Penetration Testing ankommt.
Neue Anforderungen: MVO und CRA ab 2027
Die Maschinenverordnung (MVO) und der Cyber Resilience Act (CRA) ändern die Spielregeln grundlegend. Wichtig: Sie müssen gemeinsam betrachtet werden.
MVO und CRA: Wer ist betroffen?
Von der Maschinenverordnung und dem Cyber Resilience Act sind alle Produkte mit digitalen Komponenten betroffen:
- Maschinen mit Apps oder Touchscreens
- Geräte mit WiFi, Bluetooth oder anderen Schnittstellen
- Systeme, die Daten sammeln oder übertragen
- Produkte mit Software zur Steuerung
Neue Anforderungen an Dokumentation und Prozesse. Was wird neu?
Die CE-Kennzeichnung erfordert jetzt:
- Ein Cybersecurity-Konzept über den gesamten Produktlebenszyklus
- Software-Dokumentation und regelmäßige Updates
- Incident-Response-Pläne für mindestens fünf Jahre
- Nachweis der Sicherheit auch bei vernetzten Systemen
Das Problem: Komplexität trifft Unwissen
Im Mittelstand herrscht noch große Unsicherheit darüber, was nun zu tun ist. Aber Unwissenheit schützt nicht vor EU-Verordnungen. Die Folgen: Vertragsstrafen durch nicht konforme Maschinen und verspätete Markteinführung neuer Produkte.
Die eigentliche Herausforderung liegt in der Dokumentation: Wie dokumentieren Sie Cybersecurity über Jahre hinweg? Excel-Listen und Word-Dokumente reichen nicht mehr aus. Benötigt wird ein System, das:
- Produktarchitektur mit Anforderungen verknüpft
- Hardware-Design mit Software-Sicherheit verbindet
- Audit-sichere Nachweise auf Knopfdruck liefert
- Über Jahre hinweg monitoring-fähig bleibt
Aus Pflicht wird Wettbewerbsvorteil: Chancen durch Integration nutzen
Die neuen Anforderungen bedeuten nicht nur Mehraufwand – sie eröffnen auch die Möglichkeit, Entwicklungsprozesse grundlegend zu verbessern.
Synergien nutzen: Statt Safety und Security getrennt zu betrachten, entstehen durch Integration Effizienzgewinne. Beispiel: Eine Risikoanalyse, die sowohl technische Ausfälle als auch Cyber-Bedrohungen berücksichtigt, ist aufwändiger als zwei separate Analysen – aber deutlich vollständiger und letztendlich effektiver.
Modellbasierte Entwicklung: Moderne Digital Engineering-Tools schaffen Klarheit. Statt isolierter Dokumente erhalten Sie ein durchgängiges System, in dem alle Informationen miteinander verknüpft sind. Änderungen werden automatisch in allen betroffenen Bereichen nachgeführt.
Wettbewerbsvorteile: Wer heute handelt, erfüllt ab 2027 nicht nur die Pflicht, sondern kann auch gravierende Vorteile nutzen:
- Kürzere Entwicklungszyklen durch effizientere Prozesse
- Höhere Produktqualität durch integrierte Sicherheitskonzepte
- Bessere Marktposition durch nachweisbare Cybersecurity
Handlungsempfehlungen: Der Weg nach vorn
Quick-Check: Bin ich betroffen?
- Hat mein Produkt eine App oder Software?
- Kann es sich mit anderen Geräten verbinden?
- Sammelt oder überträgt es Daten?
- Nutzt es digitale Schnittstellen?
Falls eine Frage mit „Ja“ beantwortet wird: Sie sind betroffen.
Erste Schritte:
- Expertise aufbauen: Vernetzen Sie sich mit Experten, die sowohl regulatorische Anforderungen als auch praktische Umsetzung verstehen.
- Bestandsaufnahme: Analysieren Sie Ihre aktuellen Produkte und Entwicklungsprozesse.
- Tool-Strategie: Evaluieren Sie modellbasierte Engineering-Tools, die Safety und Security integriert betrachten.
- Enablement-Partnerschaft: Suchen Sie sich Partner, die mittelständische Unternehmen beim Einstieg in die neue CE-Thematik unterstützen.
Fazit: Die Zukunft ist digital, sicher und vernetzt
Die Botschaft ist klar: 2027 ist näher als manche denken. Das CE-Kennzeichen entwickelt sich vom mechanischen Nachweis zum digitalen Kompetenzausweis. Wer diese Transformation als Chance begreift und heute die Weichen stellt, wird morgen nicht nur konform sein, sondern auch effizienter arbeiten.
Digital Engineering ist der Schlüssel zu dieser Transformation. Funktionale Sicherheit und Cybersecurity werden zu integralen Bestandteilen des Entwicklungsprozesses. Die Unternehmen, die das verstehen und umsetzen, werden die Gewinner von morgen sein.
Der erste Schritt ist immer der schwerste – aber auch der wichtigste. Informieren Sie sich, vernetzen Sie sich mit Experten, und machen Sie aus der regulatorischen Herausforderung einen strategischen Vorteil.
FAQs CE-Kennzeichnung
Was ist die CE-Kennzeichnung für Maschinen ab 2027?
Ab dem 20. Januar 2027 müssen Maschinenhersteller im Rahmen der CE-Kennzeichnung auch Cybersecurity-Maßnahmen nachweisen. Die neue Maschinenverordnung (MVO) und der Cyber Resilience Act (CRA) verpflichten Unternehmen zur ganzheitlichen Absicherung ihrer Produkte.
Welche Maschinen sind von der neuen CE-Kennzeichnung betroffen?
Alle Maschinen mit digitalen Komponenten – z. B. WLAN, Bluetooth, Softwaresteuerung oder Datenübertragung – unterliegen ab 2027 den erweiterten Anforderungen der CE Kennzeichnung.